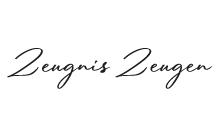Verfasst von Christiane Caspary, die selbst Teil des Netzwerks der Zeugnis Zeugen ist, bietet diese Buchbesprechung einen besonderen Blickwinkel.
Peter Modlers Buch ‚Mit Ignoranten sprechen.‘ (Stuttgart Campus 2019) beinhaltet eine große Überraschung: eine überaus gelungene Einladung zur Selbstreflexion – lesenswert! Mich machte der Untertitel des populären Lehrbuchs neugierig: ‚Wer nur argumentiert, verliert‘. Da ich mich in Alltag und Beruf zunehmend mit Situationen konfrontiert sehe, die mich sprachlos machen, fand ich eine Antwort auf meine Frage: Was gibt es für Möglichkeiten der Kommunikation außer gute Argumente?
‚Mit Ignoranten sprechen‘ ist 2019 im Campus-Verlag (Frankfurt/ New York) erschienen und umfasst 221 Seiten inclusive Literaturangaben. Das rotbraune Cover ist mit Bildsprache versehen – die bekannten drei ignoranten Affen, die ihre Sinne versperren: nicht sehen, nicht hören und nicht verstehen. Bereits in der Einführung benennt der Autor konkrete Techniken der Ignoranz, indem er eigene Erfahrungen mit dominanten Personen schildert, um später allgemeine und bekannte Beispiele aus öffentlichem Leben und Politik auszuführen. Er arbeitet er in 13 aufeinander aufbauenden Kapiteln heraus, wie sich durch das Verstehen von Kommunikationsystemen die Mechanik der Ignoranz umdrehen lässt, ‚im Interesse derer, die Argumenten am Ende zu ihrem Recht verhelfen wollen‘. (S. 18).
Seine Analyse von Sprachsystemen führt Peter Modler auf die Forschungen der amerikanischen Soziolinguistin Deborah Tanner zurück. Ihre Entdeckung war die Theorie zweier völlig unterschiedlicher sprachlicher Systeme, die im Alltag eine große Rolle spielen, aber oft unerkannt bleiben: einer ‚vertikalen‘ und einer ‚horizontalen‘ Kommunikationsstruktur. In der vertikalen Struktur spielt der Umgang mit dem Raum eine wichtige Rolle. Statusfragen sind von Bedeutung und müssen – unter Umständen wiederholt – geklärt werden. Dieses System verschließt sich der argumentativen Kommunikation. Das andere Kommunikationssystem mit horizontaler Struktur hat inhaltliche Argumentation sowie Botschaften der Zugehörigkeit im Focus. Hier wird auf der Basis einer egalitärer Beziehungsstruktur gesprochen, die Qualität des verbalen Sprechens ist hoch und Sachfragen stehen im Mittelpunkt.
Peter Modler bezieht sich in seinem Buch durchgehend auf diese beiden Strukturen. Um horizontale und vertikale Kommunikation konkret zu analysieren, werden im Weiteren drei Sprachsysteme erläutert: Wer sich mit Worten differenziert auseinandersetzt, kommuniziert ‚High-Talk‘: das Sprechen ist argumentativ und faktenreich. Beim ‚Basis-Talk‘ bleibt das Sprechen zwar verbal, wird aber auf ein Wort oder sehr kurze Sätze reduziert. Einfache Formulierungen überwiegen, es kann auch persönlich verletzend oder sexistisch werden, Fachwissen hat keine Bedeutung mehr. ‚Move-Talk‘ hingegen ist ein wirkungsvolles Sich-Positionieren im Raum. Zusammengefasst setzt High-Talk auf die Kunst des Argumentierens, während Basis-Talk und Move-Talk Hierarchiefragen im Sinn von ‚Rang und Revier‘ inszenieren (S. 30). Von geübten High-Talkern werden die Möglichkeiten des Basis-Talk und Move-Talk oft nicht erkannt, eher selten geschätzt und in der Regel auch nicht gerne ausgeführt. Der Autor nennt dies ‚intellektuellen Hochmut‘ und führt mit einem bekannten Beispiel folgenreiches Scheitern vor Augen: die Präsidentschaftsdebatten der Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump aus dem Jahr 2016. Clinton hatte sich inhaltlich hervorragend vorbereitet und war auf Hightalk fokussiert. Damit wurde von der liberalen Presse nach den Debatten als argumentative Siegerin gefeiert – verlor aber später die Wahl. Modler bringt dies in Zusammenhang damit, dass horizontale Kommunizierende High Talk für ‚die einzig wahre Form der Auseinandersetzung halten‘ (S. 37). Ihre Gegner hätten hingegen mit Basistalk und Move-Talk eine ganz eigene Virtuosität – und diese beherrsche Donald Trump ganz hervorragend. Ein Beispiel: Als Clinton ihn wortreich angriff, sagte er schlicht „falsch!“ (Basistalk) und schnitt hinter ihrem Rücken Grimassen (Move-Talk). Die kurzen Wiederholungen des Wortes ‚falsch‘ wirkten wie Panzerungen gegen Clintons gute Argumente. Möglichkeiten zur räumlichen Inszenierung geraten bei gut ausgebildeten Menschen gerne aus dem Blick, was die gleiche Höhe der Stehpulte beim Wahlkampfduell zeigte: Während der hoch gewachsene Kandidat sich eindrucksvoll am Pult positionieren konnte, musste sich die deutlich kleinere Kandidatin mühevoll mit dem Stehtisch arrangieren – Modler vermutet, dass Clintons inhaltsorientierte Berater dies nicht im Blick hatten und andere Kommunikationsebenen ihnen entgingen, aber nicht ohne Wirkung blieben.
Der Autor betont, wie wichtig es ist, anzuerkennen, dass sich nicht alle Menschen im selben kommunikativen Zeichensystem befinden. Seine zentrale Botschaft ist: es ist ein Fehler, nur eines der beiden von Tanner beschriebenen Systeme zu beherrschen. Gerade weil High-Talker auf inhaltliches Argumentieren hin orientiert sind, können sie sich die Wirksamkeit von sehr kurzen Sätzen ohne prägnanten Inhalt oder Körpersprache im Raum nicht vorstellen. Deshalb erläutert Modler im Kapitel ‚tools of resistance‘, wie man solch einer Taktik begegnen kann: ‚Bevor man also verbal antwortet, sollte man sich zuerst klar machen, ob das Gegenüber ebenfalls verbal unterwegs ist‘ (S. 94). Mit einem Beispiel aus der deutschen Politik stellt er klar: Move Talk muss mit Move-Talk begegnet werden, Basic Talk mit Basic Talk. Es lässt sich genüsslich lesen, was die Kanzlerin Angela Merkel hätte tun können, als Horst Seehofer sie als seinen Gast beim CSU-Parteitag 2015 mit einer vertikalen Inszenierung minutenlang in eine Zwangsstarre bringt. Das Vorgehen nennt Modler ‚Rangklärung‘, es soll an dieser Stelle nicht im Detail beschrieben werden. Wichtig ist zu verstehen, dass es sich um ein Statement handelt, das ‚vertikale Leute sofort zur Aufmerksamkeit zwingt und ohne jede verletzende Kante auskommt‘ (S. 95). Mit dem Beherrschen dieses dominanten vertikalen Stils kann eine Basis hergestellt werden, damit Argumenten und der demokratischen Tugend des Wortstreits wieder Raum verschafft wird. Anschaulich vergleicht der Autor zwei Szenen aus deutschen Landtagen, in denen jeweils die AfD mit massiven Angriffen die Regeln des Parlaments bekämpfte. In ‘das peinliche Glöckchen‘ (S. 147f), zeigt sich die Landtagspräsidentin eines Bundeslandes mittels High-Talk den Attacken der AfD kaum gewachsen. Im anderen Fall, ‚Showdown im Landtag‘ (S. 143), nutzt eine souveräne Landtagspräsidentin die Möglichkeiten von Basistalk (klare kurze Sätze, Wiederholungen) und Movetalk (neutraler Gesichtsausdruck, reduziertes Sprechtempo) und stellt auf diese Weise durch Rangbotschaften erst die Voraussetzungen wieder her, um inhaltlich weiter zu verfahren. Hier wird deutlich, wie kunstvolle Moderation unter Zuhilfenahme aller Kommunikationssysteme Machtausübung in einer Demokratie schützen kann.
Der Autor Peter Modler befasst sich in seinen Büchern mit Fragen von reflektierter Machtanwendung. Machtausübung sieht er, gelernter Zimmermann, promovierter Theologe, Universitätsdozent und Unternehmensberater, nicht negativ, und eine Gleichsetzung von Macht und Machtmissbrauch findet er unangemessen. Vielmehr brauche gerade eine demokratisch legitimierte Machtposition gelingende Formen der Machtausübung, die er auch als Kunstfertigkeit bezeichnet. Diese ist nicht nur eine Frage von Argumenten, sondern hat viele Facetten, welche von Modler auch in früheren Büchern mit prägnanten Titeln (u.a. „“Das Arroganz-Prinzip“, „Die Königsstrategie“) bereits untersucht wurden.
Das hier vorgestellte Buch widmet sich auch dem Arbeitsalltag, mit Beispielen aus einem Labor oder einem Firmenmeeting. So entsteht ein plastischer Bezug zum Thema, dem Leserin und Leser noch näherkommen, wenn der Autor auf das vielen Menschen bekannte Gefühl von Ohnmacht angesichts von Begegnungen mit ‚Ignoranten‘ eingeht. Es wird deutlich, dass Menschen, die High-Talk bevorzugen – häufiger sind es Frauen als Männer – an Zugehörigkeitsbotschaften, sog. Community-Orientierung, interessiert sind. Gleichzeitig finden sie es peinlich, wenn das Gegenüber auf einem dominanten Stil besteht und empfinden nicht selten ein Gefühl moralischer Überlegenheit – was sie aber auf der kommunikativen Ebene nicht weiterbringt. Wer bis hierhin aufmerksam gelesen hat, kann nun den Untertitel: ‚Wer nur argumentiert, verliert‘ verstehen – und dass es nicht nur professionell ist, zwischen beiden Sprachsystemen wechseln zu können, sondern auch im Alltag sehr hilfreich sein kann. Für diese ‚Zweisprachigkeit‘ gibt es in den hinteren Kapiteln des Buches dann noch einen ‚Werkzeugkasten‘ mit ‚Formeln‘ (S. 170) sowie 10 goldene Regeln (S. 198f) als Gebrauchsanweisung, um das eigene Kommunikationsverhalten zu überdenken.
Die Kombination zwischen anspruchsvollen Themen (soziolinguistische Theorie, Funktionieren der Demokratie) und Anregung zur Selbstreflexion ist ungewöhnlich gelingt Peter Modler mühelos, da er nie den Focus verliert: Seine zentrale These der Zweisprachigkeit untermauert er anschaulich und überzeugend. Allerdings sind die Erklärungen zur Forschung von Deborah Tannen sehr knappgehalten, und ob das System der verschiedenen Talk-Möglichkeiten auch Teil ihrer Theorie ist, wird nicht klar differenziert. Vermutlich finden sich der Leserschaft eher passionierte Argumentierende, die verwundert von einem System hören, das sie gerne weiter verleugnet hätten. Die Rezensentin fühlte sich ertappt, als um das das Gefühl von Unbehagen bezüglich direkter Machtauseinandersetzungen ging: ‚Man möchte es nicht sagen müssen!‘ (S. 106). Hier ist sie benannt, die vermeintliche moralische Überlegenheit, die Hillary Clinton dazu brachte, in eine Falle zu laufen. Der Autor nennt dies ‚Schiffbruch der Argumente‘, nämlich eine Art von Selbstüberschätzung, die reflektiert werden muss: Es geht nicht um die Frage, ob wir Basis-Talk und Move-Talk mögen. Wir müssen vielmehr zur Kenntnis nehmen, dass es diese unterschiedlichen Kommunikationssysteme gibt.
Das Buch ‚Mit Ignoranten reden‘ ist einfach zu lesen, da es in kurzen Sätzen geschrieben ist und anschauliche Beispiele Modlers Thesen anschaulich untermauern. Seine prägnante Wortwahl mag an manchen Stellen etwas flapsig wirken (‚Hierarchiefreaks‘, S. 107), es zeugt aber auch von Humor, wenn der Autor seine eigene Meinung durchblitzen lässt, ohne diese in den Vordergrund zu stellen. Mit gut 200 Seiten erscheint das Taschenbuch umfangreicher, als es ist, da Schriftbild, Ränder und Zeilenabstände großzügig gehalten sind. Man kann es sich in wenigen Stunden eines freien Wochenendes als spannende Lektüre zu Gemüte führen (was genau hätte Merkel tun können, um Seehofer aus Seehofers Falle zu kommen?), und wer sich dafür entscheidet, etwas kommunikativ lernen zu wollen, kann auf den Ratgeberaspekt fokussieren. Dieser wird sehr genau und in konkreten Schritten ausgearbeitet. Die Rezensentin selbst hat sich bei einem Restaurantbesuch im Urlaub nach Lektüre des Buches gegen zwei rüpelhafte Ignoranten am Nebentisch kunstvoll zu wehren gewusst, auch wenn sie lieber eine Hillary Clinton gewesen wäre, die sich gegenüber Donald Trump durchgesetzt hätte. Ich hatte Peter Modlers ‚Ignoranten‘-Buch im Sommer 2024 gelesen, und danach fielt es mir in schwierigen Situationen immer wieder ein. Hier möchte ich zwei Szenen skizzieren, in denen ich dabei, aber nicht direkt involviert war.
- Juni 2024. Online höre ich einen Vortrag von Moshe Zimmermann, Historiker an der Jerusalem Universität, den er in München hält. Er ist von der ‚Katholischen Akademie Bayern‘ eingeladen, um zum Thema ‚Israels Richtungsstreit um Sicherheit, Demokratie und Religion‘ zu sprechen. Die anschließende Diskussion findet nur sehr begrenzt statt, da ein Kritiker der sehr konservativen ‚Deutsch Israelischen Gesellschaft‘ aus dem Publikum lautstark, lange und ohne sachliche Argumente Redner, Moderator und Akademie beschimpft. Wie könnte er begrenzt werden, um der Diskussion nach einem interessanten Vortrag mehr Raum zu geben? ‚Movetalk‘ und ‚Basistalk‘ wären hier eine gute Orientierung.
- September 2024, Thüringen. Erste Sitzung des Landtages nach den Wahlen, aus der die AfD gestärkt hervorging und für die Eröffnung der Legislaturperiode den Alterspräsidenten stellte. Erst nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofes befolgt dieser die Regeln des Parlaments, zuvor spielen sich Szenen im Landtag ab, die als ‚chaotisch‘ bezeichnet werden müssen. Wie umgehen mit Störern, die nicht argumentieren wollen, sondern reine Machtbotschaften senden?
Modlers Buch bietet eine Möglichkeit, sich auf vergleichbare Momente vorzubereiten. Wer die Kommunikationssysteme von Deborah Tannen verstanden hat, kann sie in den Alltag integrieren – sie helfen in politisch herausfordernden Zeiten, Statements zu setzen, in der Kommunikation klar zu bleiben, dem Gefühl von Hilflosigkeit etwas entgegenzusetzen, Orientierung zu bewahren. Mit den Worten von Modler: (S. 15): ‘Der Umgang mit Ignoranten hat (…) große Bedeutung für die Demokratie‘.
Christiane Caspary
Netzwerk Zeugnis Zeugen
März 2025