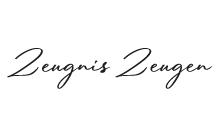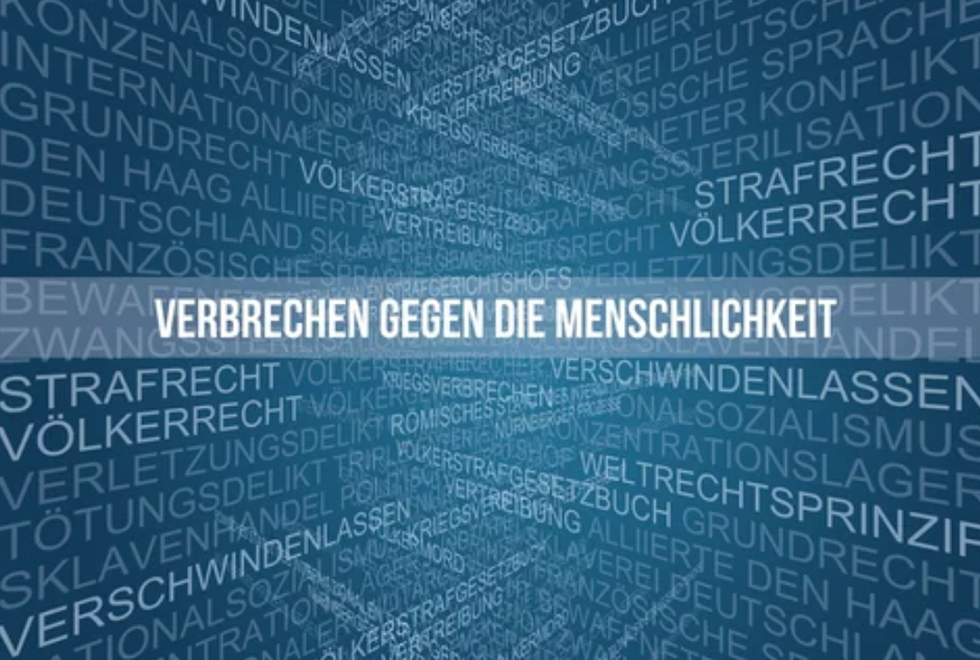Workshop „Den Tätern nahe Kommen“
Im Januar 2025 fand ein von Horst Konietzny und Prof. Dr. Klaus Weber konzipierter Workshop zur Erinnerungskultur mit besonderem Fokus auf die Thematik der Täterschaft statt. Anlass für die Veranstaltung war ein Radio-Feature, das Horst Konietzny für den WDR vorbereitet und das sich mit zeitgemäßen Methoden der Erinnerungskultur in Bezug auf die NS-Thematik auseinandersetzt.
Im Zentrum stand die Methode der Stellvertretung: eine Herangehensweise, bei der sich Teilnehmende in die Perspektive historischer Figuren versetzen, um einen unmittelbaren Zugang zur Thematik zu ermöglichen. Der Workshop sollte erfahrbar machen, wie sich nationalsozialistisches Gedankengut bei „Durchschnittsmenschen“ ausbreiten und seine zerstörerische Kraft in alltäglicher Normalität entfalten konnte – und wie wenig möglicherweise dazu fehlt, selbst zum Täter oder zur Täterin zu werden.
Nach einem einführenden Vortrag von Prof. Dr. Klaus Weber, in dem er die verschiedenen Rollen innerhalb der NS-Zeit beleuchtete und auf die psychologischen und gesellschaftlichen Bedingungen der Täterwerdung einging, stand die praktische Auseinandersetzung im Fokus. Sechs Teilnehmende, die sich bereit erklärt hatten, als Stellvertreter*innen zu agieren, erhielten am Ende des ersten Tages eine Mappe mit Informationen über eine historische Täterpersönlichkeit, auf die sie sich bis zum nächsten Tag vorbereiten konnten.
Die Stellvertreter*innen begaben sich in einen „Resonanzraum“, in dem sie sich gedanklich und emotional in die ausgewählte Täterpersönlichkeit hineinversetzten. Anschließend führte Horst Konietzny mit ihnen aus ihrer Rolle heraus ein Interview, das die zentralen Fragen des Täterbewusstseins sowie der individuellen und gesellschaftlichen Verantwortung beleuchtete.
Sowohl für die Stellvertreter*innen als auch für die weiteren Teilnehmer*innen in der Beobachterrolle war es sehr aufschlussreich zu erleben, wie gut diese Identifizierung gelang und wie stringent aus dieser Rolle heraus argumentiert wurde. Ein roter Faden in jedem Täterinterview war, dass sich bei keinem Tätervertreter ein Schuldgefühl einstellte. Alle argumentierten aus ihrer jeweiligen Rolle heraus, dass sie auf Befehl gehandelt und lediglich ihre Pflicht getan hätten. Mitgefühl und Empathie mit den Opfern wurden komplett ausgeblendet.
Zum Abschluss des Workshops wurden die Erfahrungen reflektiert und die Relevanz der Methode für zukünftige erinnerungskulturelle Projekte diskutiert. Inwiefern kann eine Annäherung an Täterperspektiven dazu beitragen, historische Prozesse besser zu verstehen und daraus Lehren für die Gegenwart zu ziehen? Eignet sich diese Methode als Vorbild für weitere Stellvertreterprojekte? Die Diskussion ergab, dass diese Methode zur Auseinandersetzung mit Täterschaft durchaus ein innovatives Modell zur Geschichtsvermittlung sein kann. Allerdings muss sie gut in weitere Bildungsangebote eingebettet sein und es bedarf einer sorgfältigen Vorbereitung. Die Frage, ob sie für die Erinnerungsarbeit mit Jugendlichen geeignet ist, wurde kontrovers diskutiert. Einig waren sich die Teilnehmenden jedoch darin, dass es sich lohnt, die Stellvertretermethode, mit der die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Entstehungsbedingungen persönlich erfahrbar wird, weiterzuverfolgen und mit weiteren Organisationen für Erinnerungskultur darüber ins Gespräch zu kommen.
Das Feature wurde am 3. Mai 2025 im WDR 3 ausgestrahlt und ist in der Mediathek abrufbar.