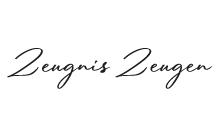Gestillt mit Tränen – Vergiftet mit Milch: Die Nazareth-Gruppenkonferenzen. Deutsche und Israelis – Die Vergangenheit ist gegenwärtig ist ein herausragendes Werk, das die tiefgreifende Auseinandersetzung zwischen deutschen und israelischen Psychoanalytiker:innen mit den transgenerationalen Folgen des Holocaust dokumentiert. Herausgegeben von H. Shmuel Erlich, Mira Erlich-Ginor und Hermann Beland, basiert das Buch auf drei einwöchigen Gruppenkonferenzen, die zwischen 1994 und 2000 in Nazareth stattfanden. Diese Konferenzen zielten darauf ab, die unbewussten kollektiven Überzeugungen und individuellen Identitätsaspekte beider Nationen im Kontext der Shoah zu erforschen.
Im Gegensatz zu traditionellen Versöhnungsinitiativen verfolgten die Nazarethkonferenzen nicht primär das Ziel der Schuldentlastung oder der Wiederannäherung der Völker. Stattdessen konzentrierten sie sich auf die psychoanalytische Erforschung der tief verwurzelten Traumata und der daraus resultierenden Identitätskonflikte. Hierbei kam die Gruppenbeziehungsmethode nach dem Tavistock-Leicester-Modell zum Einsatz, die es ermöglichte, kollektive Verwicklungen des Einzelnen zu beleuchten und individuelle Identitätsveränderungen zu fördern.
Ein zentrales Thema des Buches ist die Erkenntnis, dass die aktuelle Gegenwart des „Anderen“ – in diesem Fall die direkte Begegnung zwischen Deutschen und Israelis – entscheidend für das Erreichen von kollektiv gebundenen Identitätsüberzeugungen ist. Diese unmittelbare Konfrontation mit dem „Anderen“ ermöglichte es den Teilnehmer:innen, tief verwurzelte Vorurteile, Schuldgefühle und Abwehrmechanismen zu erkennen und zu bearbeiten.
Das Buch ist in mehrere Kapitel unterteilt, die die Geschichte des Projekts, das Design und die Struktur der Konferenzen sowie die Erfahrungen der Teilnehmer:innen detailliert beschreiben. Besonders hervorzuheben ist das Vorwort von Desmond M. Tutu, das die Bedeutung solcher interkulturellen und intergenerationellen Dialoge unterstreicht.
Gestillt mit Tränen – Vergiftet mit Milch bietet einen tiefen Einblick in die komplexen Prozesse der kollektiven Erinnerung und der individuellen Verarbeitung von Traumata. Es zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie psychoanalytische Methoden dazu beitragen können, historische Traumata zu verstehen und zu transformieren. Für Leser:innen, die sich mit den psychologischen Auswirkungen des Holocaust und der Bedeutung von interkulturellem Dialog auseinandersetzen möchten, ist dieses Buch eine unverzichtbare Lektüre.