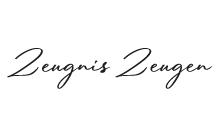In ihrem Buch Gewalt und Gedächtnis: Globale Erinnerung im 21. Jahrhundert untersucht Mirjam Zadoff, wie Gesellschaften weltweit mit den Spuren von Gewalt umgehen und welche Formen des Erinnerns dabei entstehen. Sie analysiert, wie kollektive Gedächtnisse von Kriegen, Unterdrückung und Diskriminierung in verschiedenen Ländern gepflegt oder verdrängt werden. Dabei beleuchtet sie sowohl die institutionellen als auch die individuellen Praktiken des Erinnerns, die oft von politischen und sozialen Kontexten beeinflusst sind.
Zadoff zeigt anhand von Beispielen aus aller Welt, wie Erinnerungskulturen gestaltet werden: In Italien etwa wird an die Deportation der Juden erinnert, in Japan an die Zwangsprostituierten während des Zweiten Weltkriegs, und in Johannesburg an die Opfer des Holocaust und des Kolonialismus. Sie verdeutlicht, dass diese Erinnerungspraktiken nicht nur der Vergangenheit dienen, sondern auch aktuelle gesellschaftliche Diskurse prägen und politische Implikationen haben.
Ein zentrales Thema des Buches ist die Frage, wie eine globale Erinnerungskultur aussehen kann, die die Vielfalt der Erfahrungen anerkennt und einen Dialog zwischen unterschiedlichen Gedächtnissen ermöglicht. Zadoff plädiert für eine Erinnerung, die nicht auf Ausgrenzung oder Vereinfachung basiert, sondern die Komplexität der Geschichte respektiert und zur Reflexion über die Gegenwart anregt. Sie betont, dass Erinnerung nicht nur ein Akt der Bewahrung ist, sondern auch eine aktive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die für die Gestaltung einer gerechten Zukunft unerlässlich ist.
Insgesamt bietet Gewalt und Gedächtnis einen tiefgehenden Einblick in die globalen Praktiken des Erinnerns und regt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der Frage an, wie Gesellschaften mit ihren gewaltsamen Erlebnissen umgehen und welche Lehren daraus für die Zukunft gezogen werden können.