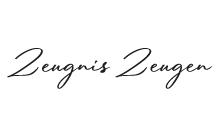Linie 41 ist ein eindringlicher Dokumentarfilm von Tanja Cummings aus dem Jahr 2015, der sich auf sehr persönliche Weise mit Erinnerung, Schuld und Vergebung im Kontext des Holocaust auseinandersetzt. Im Zentrum steht die Straßenbahnlinie 41 in Łódź (Polen), die während der deutschen Besatzung mitten durch das Ghetto führte – das zweitgrößte Ghetto nach Warschau. Während auf der einen Seite des Zauns die jüdische Bevölkerung unter unmenschlichen Bedingungen lebte, fuhr direkt daneben der öffentliche Nahverkehr – der Alltag ging weiter, als wäre nichts.
Der Film begleitet zwei Männer, die sich Jahrzehnte nach dem Krieg zum ersten Mal begegnen: den Holocaust-Überlebenden Jahnkiel Wiernik, der als Jugendlicher im Ghetto von Łódź interniert war, und Gerhard Vosskühler, einen Deutschen, der erst spät erfährt, dass sein Vater bei der SS war. Ihre Begegnung steht symbolisch für die Konfrontation mit der Vergangenheit – sowohl individuell als auch gesellschaftlich.
Besonders bewegend ist, wie der Film Gegensätze nebeneinander stellt, ohne sie gegeneinander auszuspielen: Erinnern und Vergessen, Täter und Opfer, Schweigen und Sprechen. Jahn Wiernik spricht in bewegenden, oft erschütternden Worten über seine Kindheit im Ghetto, über Hunger, Angst und das Gefühl, „aus der Welt gefallen“ zu sein. Er erinnert sich an die Straßenbahn, die direkt neben dem Stacheldraht entlangfuhr:
„Wir waren wie Tiere im Käfig. Und draußen – da war normales Leben. Man hat uns gesehen. Aber keiner hat hingeschaut.“
Gerhard Vosskühler, der als Erwachsener beginnt, die Vergangenheit seiner Familie zu erforschen, sagt an einer Stelle:
„Ich wollte wissen, ob mein Vater dabei war. Ich wollte es wirklich wissen – aber ich hatte auch Angst, es zu wissen.“
Seine Reise nach Łódź wird zu einer Reise in eine Geschichte, die lange Zeit verschwiegen oder beschönigt wurde.
Cummings verwendet in Linie 41 neben Interviews auch historische Aufnahmen, private Briefe, Fotos und Archivmaterial. Doch nie steht die Historie abstrakt im Mittelpunkt – immer geht es um persönliche Geschichten, um das Konkrete, das Menschliche. Die Linie 41 wird dabei zur symbolischen Linie zwischen Erinnerung und Verdrängung, zwischen Leben und Tod, zwischen Innen und Außen.
Der Film fragt nicht nach Schuld im juristischen Sinn, sondern nach Verantwortung – nach der Notwendigkeit, hinzusehen, zuzuhören, weiterzuerzählen. Linie 41 ist ein stiller, aber sehr eindringlicher Film über das Erinnern im Angesicht des Vergessens, über das Weiterleben mit einer Vergangenheit, die nicht vergeht.