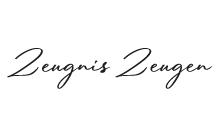Eine persönliche Empfehlung aus dem Netzwerk: Ruth Back von den Zeugnis Zeugen über ein eindrucksvolles Buch.
Der Historiker und Pädagoge Meron Mendel setzt sich in seinem Buch „Über Israel reden“ mit der Frage auseinander, wie in Deutschland über Israel gesprochen wird und welche Schwierigkeiten und Merkwürdigkeiten er dabei erlebt. Mendel ist 1976 in Israel geboren und lebt seit 2001 in Deutschland. Aus der Perspektive eines Israelis, der inzwischen auch Deutscher ist, untersucht er die deutsche Debattenkultur zu Israel, die oft von vereinfachenden Gegensätzen geprägt ist. Er analysiert die historischen und politischen Hintergründe der deutschen Israel-Debatte und zeigt auf, wie Vergangenheitsbewältigung, Schuldgefühle und moralische Imperative die Diskussion prägen. Er beschreibt, wie oft ein polarisierter Diskurs entsteht, in dem Kritik an Israel entweder als antisemitisch oder als Verrat an der Solidarität mit Palästina angesehen wird. Mit seinem Buch gelingt ihm eine eindrucksvolle Verbindung von biographischen Erlebnissen und politischer Analyse. Er schildert die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse auf anschauliche Weise und bettet sie in seine eigenen Erfahrungen ein. Gerade diese Verknüpfung macht das Buch lebendig und zugänglich.
Das Buch besteht aus vier Kapiteln.
Im ersten Kapitel beleuchtet Mendel das Verhältnis der Bundesrepublik Deutschland zu Israel, das nach der Staatsgründung Israels zunächst von Zurückhaltung geprägt und noch weit davon entfernt war, dass die Sicherheit Israels als deutsche Staatsraison gilt. Er bettet die wechselhafte politische Haltung Deutschlands zu Israel in den historischen Kontext und die jeweiligen Interessenslagen ein und verschafft dem Leser damit neue Sichtweisen.
Das zweite Kapitel beleuchtet in ihrer ganzen Vielschichtigkeit die Kontroversen um die BDS-Bewegung (Boycott, Divestment, Sanctions), die zum Boykott und zu Sanktionen gegenüber Israel aufruft. Der Umgang mit der BDS-Bewegung in Deutschland steht seiner Meinung nach als stellvertretend für den deutschen Blick auf Israel. Mendel zeigt auf, dass es unterschiedliche Formen des Boykotts gibt und es wichtig ist, deren unterschiedliche Formen und Hintergründe zu analysieren. Boykottmaßnahmen sind seiner Meinung nach nicht per se antisemitisch, auch wenn sich in der lose strukturierten und heterogenen BDS-Bewegung durchaus viele Antisemiten sammeln.
Im dritten Kapitel geht es um das wechselhafte Verhältnis der linken Milieus zu Israel sowie um den Postkolonialismus mit seiner spezifischen antirassistisch motivierten Ablehnung von Israel. Obgleich Meron Mendel sich selbst als politisch links stehend verortet, erlebt er, dass die Diskurse der Linken mit ihren eindimensionalen Deutungsmustern einer ernsthaften Auseinandersetzung schaden und einem konstruktiven Dialog im Wege stehen.
Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit der deutschen Erinnerungskultur. Besonders eindrucksvoll ist Mendels Auseinandersetzung mit der Frage des Vergleichens und Bewertens historischer Ereignisse. Er plädiert für die Möglichkeit, den Holocaust mit anderen Menschheitsverbrechen zu vergleichen – nicht, um ihn zu relativieren, sondern um Unterschiede und Besonderheiten besser verstehen zu können. Mendel macht deutlich, dass Vergleiche nicht mit Gleichsetzungen verwechselt werden sollten und dass ein Vergleichsverbot eher Denkblockaden schafft, anstatt Erkenntnisse zu ermöglichen.
Mendel schreibt aus der Perspektive eines linken Israelis, der der Politik von Benjamin Netanjahu und der aktuellen Entwicklung in Israel kritisch gegenüber steht. Als Israeli in Deutschland erlebt er, dass seine Stimme auf ein anderes Echo stößt als in Israel selbst und er Gefahr läuft, in die Rolle des jüdisch-israelischen Kronzeugen zu geraten. Er verwahrt sich dagegen, dass seine Kritik an der jetzigen israelischen Regierung von Personen zitiert wird, die einseitig Schuld zuweisen möchten. Dem vereinfachenden Schwarz-Weiß-Denken stellt er die Herausforderung der Differenzierung entgegen. Das Buch wird deshalb weder denjenigen gefallen, die sich solidarisch mit den Palästinensern erklären noch denjenigen, die bedingungslose Solidarität mit Israel fordern. Mendel argumentiert, dass es notwendig ist, jüdische Perspektiven in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und zwischen verschiedenen politischen Strömungen in Israel zu unterscheiden. Zudem zeigt er auf, wie die Geschichte des Nahostkonflikts oft verkürzt dargestellt wird und zeigt Empathie für beide Seiten. Damit ermöglicht er dem Leser eine differenzierte Sichtweise jenseits pauschaler Urteile. Seine Analyse zeigt, dass Polarisierung nicht zu einem besseren Verständnis führt, sondern differenzierte Betrachtungsweisen notwendig sind, um der Vielschichtigkeit des Nahostkonflikts gerecht zu werden.
Ein weiteres zentrales Anliegen Mendels ist es, die Widersprüche, die in der deutschen Israel-Debatte bestehen, zu benennen und auszuhalten. In Deutschland sei die Haltung zu Israel oft von einem Wunsch nach Eindeutigkeit geprägt, der dazu führt, dass reale Widersprüche ausgeblendet werden. Mendel plädiert für einen kritisch-konstruktiven Dialog, der nicht abreißen darf, und dafür, auch schwierige Themen offen zu diskutieren. Denn Rechthaberei, moralische Überheblichkeit und einseitige Identifikation gibt es in dieser Debatte bereits mehr als genug. Diese Perspektive hat für die Leser einen befreienden Charakter: Sie erlaubt es, sowohl jüdische als auch palästinensische Gruppierungen differenziert zu betrachten, sich mit verschiedenen Positionen auseinanderzusetzen und die Befangenheit zu verlieren, die in Deutschland oft vorhanden ist.
„Über Israel reden“ ist ein Buch, das zum Nachdenken anregt und den Leser ermutigt, sich ohne Angst oder Vorurteile mit einem oft kontroversen Thema auseinanderzusetzen. Mendel gelingt es, Brücken zu bauen, anstatt Gräben zu vertiefen. Seine Analyse ist klug, ausgewogen und von einem tiefen Verständnis sowohl für die israelische als auch die deutsche Perspektive geprägt. Obwohl das Buch bereits vor dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 veröffentlicht wurde, hat es nichts von seiner Aktualität verloren und leistet gerade in diesen Zeiten einen wertvollen Beitrag zu einer sachlichen und differenzierten Auseinandersetzung.
Ruth Back
Netzwerk Zeugnis Zeugen