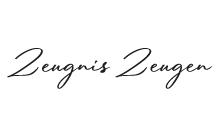Der Podcast „Searching Blanka“ ist eine vierteilige Dokumentarserie des Deutschlandfunks aus dem Jahr 2023, die sich mit dem Leben und dem gewaltsamen Tod der Holocaust-Überlebenden Blanka Zmigrod befasst. Die Serie wurde von den Journalist:innen Marina Schulz und Fabian Janssen konzipiert und erzählt eine Geschichte von Überleben, Erinnerung und dem langen Kampf um Gerechtigkeit.
Inhalt und Aufbau
Blanka Zmigrod überlebte vier Konzentrationslager, darunter Auschwitz, und wanderte 1950 nach Israel aus. 1960 kehrte sie nach Frankfurt am Main zurück, wo sie mit ihrem Lebensgefährten ein Restaurant betrieb. Nach seinem Tod arbeitete sie als Garderobenfrau in einem Frankfurter Restaurant. Am 23. Februar 1992 wurde sie auf dem Heimweg von dem schwedischen Rechtsterroristen John Ausonius erschossen. Obwohl der Täter bereits kurz nach der Tat ermittelt wurde, dauerte es 26 Jahre, bis er 2018 in Deutschland für den Mord verurteilt wurde. Das Gericht erkannte jedoch kein politisches oder rassistisches Motiv an.
Die vier Folgen im Überblick
1. Auschwitz überlebt, in Frankfurt ermordet
Beleuchtet die Tatnacht und die späte Verurteilung des Täters. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Polizei und Justiz auf dem rechten Auge blind waren.
2. Zurück ins Land der Täter
Erzählt Blankas Lebensweg von der Überlebenden zur Geschäftsfrau in Frankfurt. Die Episode beleuchtet ihre Rückkehr nach Deutschland und die persönlichen Beweggründe dafür.
3. Ein Vorbild für den NSU?
Untersucht Parallelen zwischen Ausonius‘ Taten und denen des NSU. Es wird diskutiert, ob Ausonius ein Vorbild für den NSU war und ob sein Mord an Blanka Zmigrod doch eine rechtsextreme Tat war.
4. 26 Jahre Warten auf Gerechtigkeit
Beschreibt die späte juristische Aufarbeitung und die Erinnerungskultur rund um Blanka Zmigrod. Die Folge thematisiert die Frage, warum der Fall so lange ungelöst blieb und welche Lehren daraus gezogen werden können.
Bedeutung
„Searching Blanka“ ist mehr als eine True-Crime-Serie. Sie ist ein eindringliches Porträt einer Frau, deren Geschichte lange unbeachtet blieb, und ein kritischer Blick auf den Umgang der deutschen Justiz mit rechtsextremer Gewalt. Der Podcast regt zum Nachdenken über Erinnerungskultur, institutionelles Versagen und die Rolle der Medien bei der Aufarbeitung solcher Fälle an.
Für alle, die sich für Zeitgeschichte, investigative Recherchen und gesellschaftliche Aufarbeitung interessieren, ist dieser Podcast eine eindrucksvolle und bewegende Empfehlung.