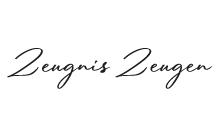Claude Lanzmanns Shoah ist kein gewöhnlicher Dokumentarfilm. Der über neuneinhalbstündige Film, der 1985 veröffentlicht wurde, verzichtet vollständig auf Archivmaterial und konzentriert sich stattdessen ausschließlich auf Interviews mit Überlebenden, Tätern, Zeugen und Historikern des Holocaust. Lanzmanns Ansatz ist radikal: Er will nicht zeigen, er will erzählen lassen. Der Schrecken des Holocaust wird nicht durch Bilder von Leichenbergen vermittelt, sondern durch die Gesichter und Stimmen derer, die dabei waren – und durch das, was sie sagen, was sie nicht sagen können oder nicht sagen wollen.
Ein zentrales Thema von Shoah ist die Erinnerung – und deren Zerbrechlichkeit. Der Überlebende Abraham Bomba, ein Friseur, erzählt mit brüchiger Stimme, wie er im Vernichtungslager Treblinka anderen Häftlingen die Haare schneiden musste, bevor sie in die Gaskammern gingen. Während er spricht, steht er in einem Friseursalon in Tel Aviv und führt eine Rasur durch. Die Kamera bleibt unbewegt auf seinem Gesicht. In einer der ergreifendsten Szenen sagt er:
„Man musste die Frauen beruhigen… Sie wussten ja nicht… Und wir – wir wussten.“
Ein anderes prägendes Moment liefert der polnische Bauer Henrik Gawkowski, der als Lokführer Züge mit jüdischen Gefangenen nach Treblinka fuhr. In einer Szene fährt er gemeinsam mit Lanzmann im Zug entlang derselben Strecke, und er sagt:
„Ich war immer betrunken, wenn ich die Züge fuhr. Ich konnte es sonst nicht ertragen.“
Diese nüchterne Aussage bringt eine ganze Welt des Schweigens, der Schuld und der Verdrängung zum Vorschein.
Lanzmann konfrontiert auch Täter, etwa Franz Suchomel, einen ehemaligen SS-Mann aus Treblinka, der sich nur bereit erklärte, anonym zu sprechen – doch Lanzmann filmt ihn heimlich. Suchomel erklärt:
„Vergessen Sie nie! Vergessen Sie nie, was Sie hier hören.“
Es ist eine paradoxe, erschütternde Warnung aus dem Mund eines Täters.
Die Struktur von Shoah ist nicht chronologisch, sondern kreisförmig. Lanzmann kehrt immer wieder zu denselben Orten zurück – Treblinka, Sobibór, Auschwitz –, als müsste er sie beschwören, gegen das Vergessen anschreiben. Die Interviews sind nicht kurz, sondern lang, manchmal unangenehm lang, und genau darin liegt ihre Kraft: Lanzmann zwingt seine Gesprächspartner, sich zu erinnern, sich zu stellen.
Shoah ist kein Film, den man „sieht“ im klassischen Sinne. Er ist eine Erfahrung, eine Konfrontation. Claude Lanzmann selbst sagte einmal:
„Shoah ist nicht ein Film über den Holocaust. Shoah ist der Holocaust.“
Und so steht dieser Film nicht nur als dokumentarisches Werk, sondern als monumentales, ethisches und künstlerisches Zeugnis menschlicher Abgründe – und des Überlebens.